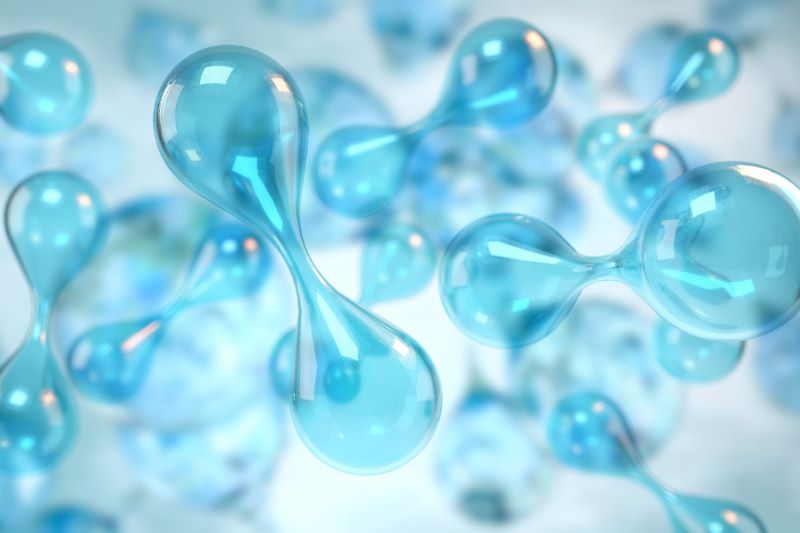Der Umfang und die Qualität der Infrastrukturausstattung eines Landes sind eng mit dem Wohlstandsniveau verknüpft. Auch wenn die Kausalitäten nicht unbedingt eindeutig geklärt sind, wird vielfach davon ausgegangen, dass die Infrastrukturausstattung eine wesentliche Determinante eines hohen Niveaus von Bruttoinlandsprodukt und gesellschaftlichen Wohlstandes ist. Deshalb wird es vielfach mit Sorge gesehen, dass die öffentlichen Investitionen in Deutschland im längerfristigen Vergleich deutlich weniger stark gestiegen sind als das Bruttoinlandsprodukt; ihr Anteil am BIP hat sich von 4,7 % im Jahr 1970 auf 1,5 % im Jahr 2012 verringert (Angaben der VGR). Zwar besteht die öffentliche Infrastruktur zum größten Teil aus Bauten, die eine lange Nutzungsdauer aufweisen. Eine nachlassende Investitionstätigkeit muss daher nicht notwendigerweise auch zu einer Beeinträchtigung des Bestands an Infrastruktureinrichtungen führen: so ist das öffentliche Anlagevermögen trotz niedriger Zuwächse auch weiter gestiegen. Allerdings ist der Modernitätsgrad des staatlichen Anlagevermögens1 von 1991 bis heute um 7 Prozentpunkte gesunken. Das Durchschnittsalter der öffentlichen Infrastruktur ist parallel dazu von 22,1 Jahren zu Beginn der 1990er Jahre auf 28,4 Jahre zum Ende des vergangenen Jahrzehnts angestiegen. Betroffen hiervon ist vor allem die Gemeindeebene, die für rund 60 % der gesamten Infrastrukturinvestitionen in Deutschland verantwortlich ist. Daher wird seit geraumer Zeit eine deutliche Erhöhung der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen gefordert, wobei die Verkehrsinfrastruktur im Mittelpunkt steht.
Über Investitionsdefizite bei der deutschen Verkehrsinfrastruktur wird nicht erst seit den letzten Jahren debattiert. Schon in den 1980er Jahren haben Fachwissenschaftler, Wirtschaftsforschungsinstitute und Interessenvertreter auf einen abnehmenden Modernisierungsgrad hingewiesen und die Einschätzung vertreten, dass sich der technische Zustand rapide verschlechtere und Engpässe aufgrund unterlassener Erweiterungsinvestitionen drohten. Erst in der jüngeren Vergangenheit jedoch haben sich auch eine breitere Öffentlichkeit und vor allem die Medien des Themas bemächtigt. Aufgrund spektakulärer Vorkommnisse, wie etwa Sperrungen oder Gewichtsbegrenzungen bei Brücken, Verspätungen der Bahn, augenfälligen Schäden an Kommunalstraßen usw., gerät dabei vor allem der schlechte Erhaltungszustand der Verkehrsinfrastruktur vermehrt in das Zentrum der Aufmerksamkeit (DEUTSCHLANDFUNK, 2013).
Befürchtet werden negative Konsequenzen niedriger öffentlicher Investitionen auf das Wachstum des Produktionspotentials in Deutschland. Vor diesem Hintergrund wurde die Kommission „Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ (Daehre-Kommission) am 1. Dezember 2011 von der Verkehrsministerkonferenz damit beauftragt, neben Vorschlägen für eine zukünftige Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur auch eine umfassende Bestandsaufnahme des Investitionsbedarfs vorzulegen. Seitdem steht die Zahl eines Investitionsbedarfs von jährlich zusätzlich 7,2 Mrd. Euro über 15 Jahre im Raum, das meiste davon Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen. Wirtschaftsforschungsinstitute, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) oder auch das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), haben einen erheblichen Rückstand an Investitionen in die öffentliche Infrastruktur konstatiert und eine drastische Investitionsoffensive in den Bereichen Bildung, Energie und Verkehr gefordert (DIW, 2013). Allein im Bereich Verkehr stellt das DIW eine Investitionslücke von 10 Mrd. Euro pro Jahr fest (KUNERT UND LINK, 2013).
Dabei ist die abnehmende Bedeutung öffentlicher Investitionen nicht unbedingt ein ausschließlich deutsches Phänomen, sondern in ähnlicher Weise auch in einigen anderen OECD-Ländern zu beobachten. Dies wirft u.a. die Frage auf, ob es sich dabei um eine für entwickelte Volkswirtschaften wie Deutschland typische und deshalb „quasi-natürliche“ Entwicklung (beispielsweise als Folge von Sättigungseffekten und daraus resultierend niedrigerer Renditen öffentlicher Investitionen) oder um eine bewusste oder unbewusste Folge wirtschafts- und finanzpolitischer Entscheidungen handelt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat daher die Dresdner Niederlassung des ifo Instituts mit einer Kurzexpertise beauftragt, mit der die Frage beantwortet werden soll, ob die rückläufige Bedeutung öffentlicher Infrastrukturinvestitionen tatsächlich ein wirtschaftspolitisches Problem darstellt.