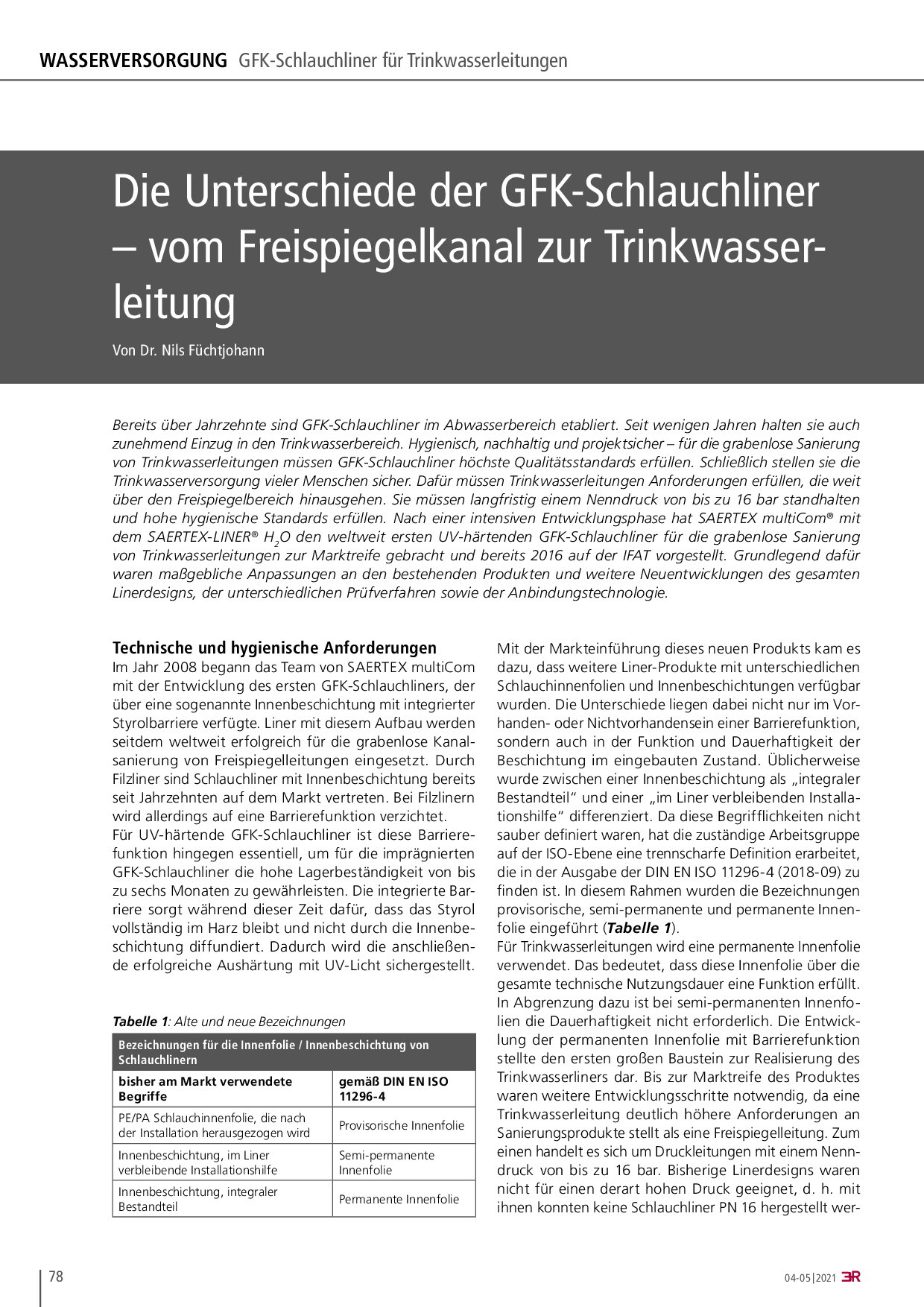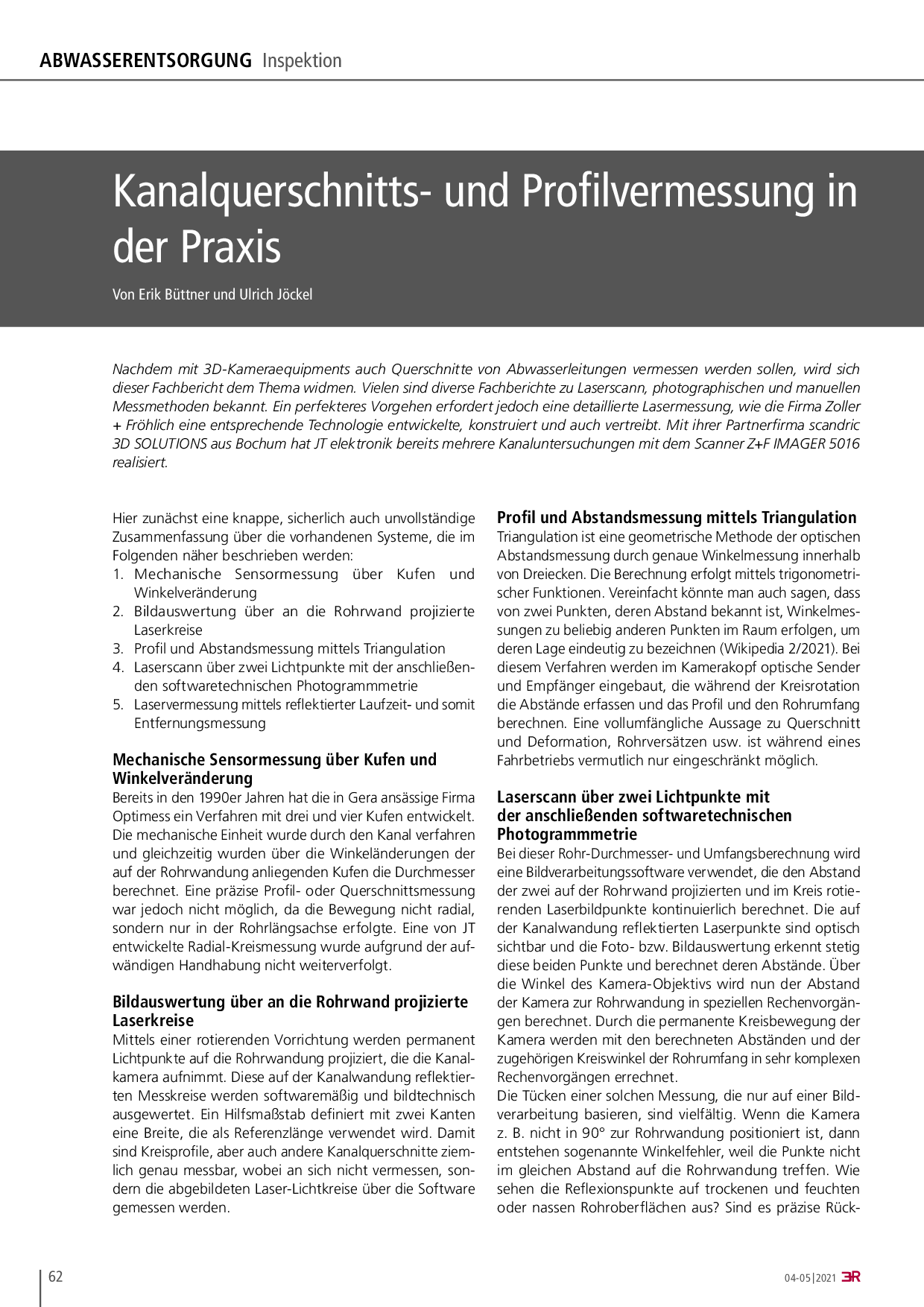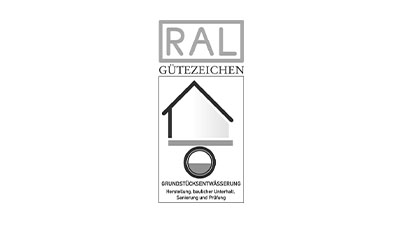Seit über 100 Jahren werden Kalisalze im Südharzrevier zunächst bergmännisch und später auch sohlend abgebaut und zu Kalidüngemittel verarbeitet. Schon früh kam es bei der Kalidüngemittelproduktion durch produktionsbedingte Salzabwassereinleitungen zu Problemen bei der Fließgewässerbewirtschaftung der unmittelbar betroffenen Wassereinzugsgebiete unterhalb der Kalistandorte.
Bereits Anfang der 1920er Jahre sah man sich gezwungen durch staatliche Stilllegungsverordnungen und Produktionsvorgaben die Salzabwasserfracht zu begrenzen. In den 1950er und 60er Jahren wurden mittels Salzlaststeuerung nach festgelegten Grenzwerten sowie Abstoßvorgaben weitere Restriktionen vorgenommen und in den Folgejahrzehnten die Umweltauflagen verschärft.
Das Kaliwerk Volkenroda hat bis Ende der 1970er Jahre über das Flussgebiet der Helbe die anthropogene Salzbelastung der Unstrut, ein Nebenfluss der Saale, mit beeinflusst. Im Rahmen einer Flussgebietsteilsanierung wurde dann ein Haldenabwasserstapelbecken errichtet. Dieses System der Stapelung von Haldenabwasser war ein erster Schritt zur Sanierung der Helbe von der anthropogenen Salzfracht.
Mit der Stilllegung aller Südharz-Kaliwerke nach den politischen Umwälzungen entstand Anfang der 1990er Jahre eine neue Situation für die Region Nordthüringen. Das Bergwerk Volkenroda wurde 1990 stillgelegt und ist heute ein Nachsorgebetrieb der Gesellschaft für Verwahrung und Verwertung mbH (GVV) mit Sitz in Sondershausen.
Gemäß bergrechtlichem Sonderbetriebsplan „Flutung der Gruben Volkenroda/Pöthen zur Entsorgung permanent aus der Halde Volkenroda witterungsbedingt emittierter Salzlösung“ werden die Haldenabwässer der Rückstandshalde Volkenroda seit 1998 über eine Flutungsbohrung für den Flutungsprozess der Grube Volkenroda eingesetzt. Im Jahr 2011 nahm eine weitere Flutungsbohrung den Probebetrieb auf.
Zu dieser Flutungsbohrung war eine 5 km lange unterflurige Haldenabwasserleitung, die den Anforderungen an die Technische Regel für Rohrfernleitungen (TRFL) erfüllt, neu zu planen. Diese Leitungstrasse vom Stapelbecken Menteroda nach Urbach liegt eine zeitlich begrenzte Betriebsdauer zu Grunde, bis die ausgewiesenen, lufterfüllten Grubenhohlräume erschöpft sind.
Die Trasse für diese Haldenabwasserleitung wurde nach örtlichen und topografischen Gegebenheiten festgelegt. Trotz der Vorgabe, bebaute Gebiete möglichst nicht zu tangieren, konnte nicht vermieden werden, dass die Leitung in unmittelbarer Nähe von Wohngrundstücken sowie einem Wirtschaftshof vorbei führt. Geplant wurde eine Leitungstrasse, die überwiegend im freien Gelände als Gravitationsleitung fungiert. In der Nähe von urbanen Bereichen lag entsprechend ein besonderes Schutzbedürfnis für die Liegenschaften vor, weshalb eine erweiterte Leckagekontrolle zum Einsatz kommen sollte.
Lösungsansatz
Der Auftraggeber wünschte sich ein Rohrsystem, welches die Vorteile aus einer „Einrohrverlegung“ bietet und die Anforderungen an den Bescheid des zuständigen Bergamtes erfüllt.
Hier wurde bereits frühzeitig die Verwendung von sogenanntem 3L-Leak Control Rohr favorisiert – einem Rohrsystem mit integrierter Detektionsschicht zur kontinuierlichen Lecküberwachung – welches sich in Thüringen für Spezialanwendungen in sensiblen Bereichen (Trinkwasserschutzzonen etc.) bereits mehrfach in der Praxis bewährt hatte.
Das 3L-Rohr ist ein dreischichtiges Rohrsystem. Die aus Aluminium bestehende, leitfähige Detektionsschicht wird durch den äußeren Mantel gegenüber dem Erdreich isoliert. Diese Detektionsschicht wird mit einem Messstrom beaufschlagt. Wird die äußere Isolationsschicht beschädigt, kann über eine Überwachungseinheit eine Veränderung gemessen werden. Die zum System gehörende Messtechnik ermöglicht eine metergenaue örtliche Festlegung eines eventuellen Schadens am Rohrsystem.
Die gesamte Rohrtrasse wurde in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Randbedingungen eingeteilt. Der Leitungsbereich 1 ist als urban beeinflusster Bereich definiert worden, wohingegen der Leitungsbereich 2 unter geringerem urbanen Einfluss steht. Diese Unterteilung in zwei verschiedene Leitungsbereiche fand auch Berücksichtigung bei den zu definierenden Überwachungskonzepten dieser Bereiche.
Überwachungskonzept Leitungsbereich 1: urban beeinflusster Bereich
Der Leitungsbereich 1 in einer Länge von 1926 m wurde in jeweils 6 Leitungsabschnitte, sogenannte Sektoren, unterteilt. Die Sektorentrennung orientierte sich dabei an Fixpunkten im Leitungsverlauf (u. a. an Schachtbauwerken). Die Überwachung der einzelnen Leitungssektoren erfolgt durch nur eine Überwachungseinheit, die im Bereich des Schieberhauses am Stapelbecken installiert wurde. Dabei wird jeder Sektor separat überwacht und mit einer Durchgangsmessung ausgestattet.
Für eine noch schnellere Schadensortung wurde parallel zur überwachbaren Leitung ein Schadensortungskabel verlegt. Dieses verfügt über Sensoren mit definiertem Abstand, um die Lokalisierung eines Schadensortes weiter zu beschleunigen.
Überwachungskonzept Leitungsbereich 2: weniger urban beeinflusster Bereich
Im Leitungsbereich 2 mit einer Rohrleitungslänge von 3.058 m wurde auf den Einsatz einer Schadensortungskette aufgrund der örtlichen Situation verzichtet. Um auch in diesem Leitungsbereich ein hohes Maß an Sicherheit zu erreichen, ist die Rohrleitung ebenfalls in einzelne Überwachungssektoren unterteilt worden. Der längste von insgesamt 4 Überwachungssektoren liegt im Bereich einer landwirtschaftlichen Fläche und beträgt etwa 1500 m. Jeder dieser Sektoren wird zusätzlich mit einer Durchgängigkeitskontrolle überprüft.
Mit der Durchgängigkeitskontrollen wird sichergestellt, dass die Rohrleitung über den gesamten Sektorenabschnitt überwacht wird. Für die Realisierung der Überwachung und der Durchgängigkeitskontrolle wurde zusätzlich parallel zur Rohrleitung ein Steuerkabel in einem Schutzrohr verlegt. Die Installation der Überwachungseinheit wurde im Bereich des Laugenstapelbeckens Menteroda realisiert.
Schächte mit Leckkontrolle
Die im Bereich der Rohrleitung zum Einsatz kommenden Schächte wurden in Beton ausgeführt. Da die Schächte mit metallischen Armaturen ausgestattet wurden, die nicht ohne weiteres in das Lecküberwachungssystem integriert werden können, wurden die Schachtbauwerke mit einer separaten Lecküberwachung ausgestattet. Hierbei kommen Füllstandmesser zum Einsatz. Bei einem Flüssigkeitsaustritt, der durch eine undichte Verbindungsstelle der metallischen Einbauarmaturen verursacht werden könnte, wird diese Leckage zeitverzögert registriert und signalisiert. Die Überwachung der einzelnen Schächte erfolgt über die Überwachungseinheiten.
Die Verlegung der Rohre erfolgte in offener Bauweise. Aufgrund des Rohraufbaus sowie des eingesetzten Rohmaterials konnte auf eine Sandbettung verzichtet werden. Bei dem Projekt wurde weitestgehend das Aushubmaterial für die Verfüllung der neuen Rohrleitung verwendet. Hier ergaben sich erhebliche Einsparungen durch den Wegfall des Bodenaustausches.
Die Verlegung erfolgte – in Abhängigkeit der Bodenverhältnisse und der Zwangspunkte – in Regeltiefen von 1,60 m. Die längskraftschlüssige Verbindung wurde überwiegend mittels Heizelementstumpfschweißungen durchgeführt, an Zwangspunkten kam darüber hinaus das Heizwendelschweißverfahren zum Einsatz.
Fazit
Mit dem eingesetzten Rohrsystem konnte eine kontinuierliche, lückenlose Lecküberwachung über den gesamten Leitungsverlauf ermöglicht werden. Das Rohrmaterial ist aufgrund seiner Eigenschaften für den Einsatz in Bergsenkungsgebieten prädestiniert. Die Aufteilung der Leitungstrasse in einzelne Überwachungssektoren und darüber hinaus der zusätzliche Einsatz von Schadensortungsketten ermöglicht eine schnelle und zielgerichtete Ortung eines Fehlerortes innerhalb des Rohrsystems, die zusätzliche Überwachung der Schächte gibt ein Höchstmaß an Sicherheit. Alle Überwachungselemente der jeweiligen Leitungsabschnitte werden in Überwachungseinheiten zusammengeführt, der Zustand der Leitungssektoren und der Schächte wird somit zentral über diese Überwachungseinheiten registriert. In dem Zeitraum von August 2010 bis Juni 2011 wurden die Rohre verlegt, seitdem ist die lecküberwachte Leitung störungsfrei im Betrieb.
Kontakt:
Dipl.-Ing.(FH) G. König, Ingenieurbüro G. König, Sondershausen, E-Mail: ingenieurbuero_koenig@t-online.de
egeplast international GmbH, www.egeplast.de